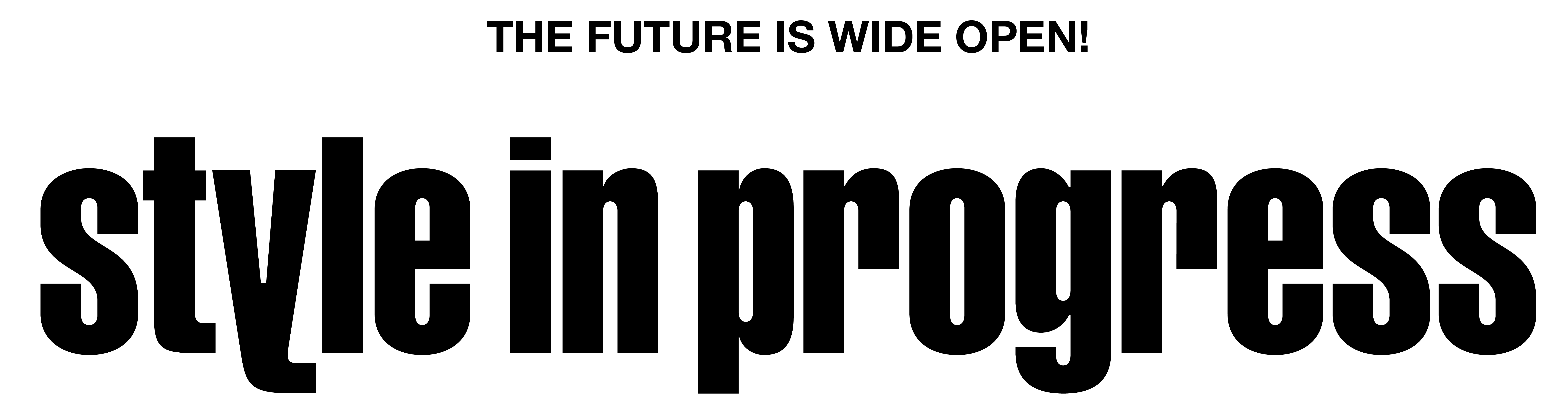Startseite » Johnnie Boden | „Man muss für Smartphone-Bildschirme designen“
Johnnie Boden | „Man muss für Smartphone-Bildschirme designen“

Farbenfrohe, kreative Mode für Frauen, Herren und Kinder, stets mit einer subtilen britischen Note – das hat Boden zu einer der erfolgreichsten britischen Marken werden lassen. Auf das Jahr 2020 freut sich Johnnie Boden, weil „ich scharf auf wirklich gute Nachrichten bin und wir davon in letzter Zeit nicht besonders viele hatten“. Ein verschärfter Wettbewerb, der Wandel vom Kataloghändler zum Onliner und generelle Marktprobleme fordern das Familienunternehmen auf, anders zu denken und zu handeln. Doch in einem ist sich Johnnie Boden sicher: In Internationalisierung und Expansion liegt das Heil nicht – zumindest, wenn die Hausaufgaben nicht erledigt sind. Daher ist seine Devise: Profit vor Umsatz. Anfangen, handeln, an den kleinen und großen Stellschrauben gleichermaßen akribisch drehen, der Engländer ist ein Chef von der anpackenden Sorte.
Interview: Stephan Huber. Text: Veronika Zangl. Fotos: Jennifer Endom
Sie waren ursprünglich Lehrer. Haben Sie irgendetwas aus dieser Berufswahl für Ihr Unternehmen brauchen können?
Ja, ich war Lehrer, aber für das, was ich heute mache, hatte ich überhaupt keine Ausbildung. Ich habe alles im Arbeiten gelernt. Das Rüstzeug für diese Karriere steckt wohl tief in meiner Kindheit.
Warum also die Mode?
Ich bin mehrfach in die USA gereist und das dortige Katalogbusiness mit J. Crew oder Lands’ End fand ich interessant, auch wenn ich selbst nie etwas aus dem Katalog gekauft habe. Ich begann zu überlegen, wie das in UK funktionieren könnte. Als ich dann eine unerwartete Erbschaft von meinem Onkel machte, konnte ich mir davon eine Wohnung kaufen und dann hatte ich noch etwas übrig. Schon als Schulkind habe ich mich für Kleidung interessiert. Als ich acht Jahre alt war, fotografierte ich die Schuhe meiner Mutter. Und als ich nach Eton ging, fuhr ich nach London und kaufte in Portobello meine Tweed-Mäntel und in einem Laden namens Flip, einem amerikanischen Vintage Store in Covent Garden High Top Converse dazu. Ich habe mich immer für Mode interessiert und als ich so kläglich in meinem Job scheiterte, war der Moment gekommen.
Sie haben also erst mal ein Paar Handschuhe entworfen?
Ja, das war eines der Dinge. Ich hatte einen Vater, der ziemlich altmodisch war und ich bekam nie ein Lob für irgendetwas, er war ziemlich hart. Er war in vielerlei Hinsicht ein erstaunlicher Mann, in anderen Dingen wieder ziemlich schwierig. Einer der Vorteile einer solchen Kindheit ist, dass Sie recht gut darin sind, Ratschläge zu nehmen. Ich war einerseits voll Vertrauen, andererseits ziemlich unsicher. Aber ich war gut darin, herumzufragen und so gute Tipps zu bekommen. Ich fand einen Freund eines Freundes, der eine Fabrik besaß. Das ging tatsächlich alles sehr schnell und einfach. Ich fand Produzenten, Fotografen, PR-Berater. Das Unternehmen aufzusetzen, war vergleichsweise einfach. Der harte Teil kam erst – das alles auch erfolgreich werden zu lassen.

Wie essenziell ist Bodens Britishness?
Darüber denken wir auch viel nach – es ist sehr wichtig. Zu Beginn war uns das überhaupt nicht bewusst, wir dachten überhaupt nicht international. Erst als uns auffiel, dass wir viele amerikanische und deutsche Kunden in unserer Datenbank hatten, war die Idee geboren, die Marke zu internationalisieren. Die britische Note zeichnet uns aus, aber weil die deutschen und amerikanischen Kunden anspruchsvoll sind, niemals platt: Sie kaufen es nicht, weil wir einen roten Bus draufmachen.
Für uns als Kontinentaleuropäer ist er sichtbar, der britische Touch.
Woran genau machen Sie den fest?
Schwierig zu erklären, es ist die Art und Weise, wie Sie mit Farben und Mustern spielen.
Ein bisschen mutiger, nicht wahr?
Ja, genau. Ein anderer Look.
Das ist uns ganz wichtig: Es darf nicht zu bewusst sein, in dem Moment, in dem Kunden es genau benennen könnten, würde ich mir Sorgen machen. Denn es muss ein subtiler Akzent bleiben.
Wie bereitet man sich als britisches Unternehmen auf den Brexit vor?
Wir wissen einfach nicht, was passieren wird. Wir haben auch nur grobe Ideen. Also werde ich das Geld, das wir brauchen, um mit den Folgen klarzukommen, lieber erst ausgeben, wenn wir es genau wissen, als dass ich jetzt möglicherweise in eine falsche Brexit-Vorbereitung investiere.
Sie sagten mal: „Jeder muss ein Omnichannel-Händler sein.“
Das habe ich gesagt, ja, aber ich weiß nicht, ob das heute noch richtig ist. Selbstverständlich müssen Kunden die Möglichkeit haben, die Kleidung zu berühren und zu sehen. Aber davon, dass wir hunderte von Geschäften eröffnen, bin ich nicht mehr überzeugt.
Neben den eigenen Stores reizt Sie jetzt auch der Großhandel?
Aus finanzieller Perspektive ist das interessant, aber aus meiner Markensicht empfinde ich es schwierig. Sie haben dann nicht mehr die volle Kontrolle über die Marke, kein eigenes Erscheinungsbild am PoS.
Wobei Sie sich ja darauf verlassen können, dass Sie schon eine starke Marke sind.
Doch, aber ist es der richtige Schritt auf Leute zu, die noch nie von dir gehört haben? Da bin ich mir nicht sicher.
Es ist also noch nicht beschlossene Strategie, sondern ein Versuch?
Ja, genau. Es ist richtig, Dinge auszuprobieren und in Konsequenz auch wieder sein zu lassen, wenn es nicht funktioniert. Großhandel ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil unseres Geschäfts. Katalog und Web bleiben unsere wichtigsten Säulen.
Wie schwierig war es, das Kataloggeschäft in ein Onlinegeschäft zu transformieren?
Die Leute stellen sich das sehr einfach vor. Der wichtigste Vorteil ist, dass man Lager und Logistik nicht aufbauen muss. Es besteht schon ein Callcenter und die Erfahrung im Warehousing ist ein Riesenvorteil. Der Katalog hat einen großen Nachteil: Sie produzieren ihn und tun so, als ob alles noch verfügbar ist, wenn ihn ihre Kundin am Küchentisch durchblättert. Ruft sie an und erfährt, dass ihr Lieblingsartikel nicht mehr erhältlich ist, ist sie enttäuscht. Online entfernen Sie ausverkaufte Artikel einfach. Das verändert den Einkauf völlig, da kann man auch mal kleine Stückzahlen produzieren lassen, während man sich für den Katalog einfach gewisse Mengen aufs Lager legt, um die Kunden nicht zu enttäuschen.
Die Verkaufspyschologie ist in beiden Medien völlig verschieden. Im Katalog geben wir eine Menge Geld aus, damit die Fotos schön aussehen, fürs Web brauchen wir wieder eine ganz andere Fotografie. Das korrespondiert kaum miteinander.
Zurück zu Ihren Plänen für den stationären Handel im deutschsprachigen Raum.
Ich glaube in zehn Jahren kann man davon sprechen, dass wir wirklich in Deutschland sind. Wir schauen uns erst mal alles an, Großhandel, alles. Wir stecken die Zehen ins Wasser.
Der Wettbewerb ist heute deutlich härter, gerade auch online. Jeder muss seine Antworten darauf finden, was er wem in Zukunft wo und wie verkaufen will – und warum. Als Inhaber führen Sie ein relativ gesundes Unternehmen in diese Zukunft – allein das ist schon bemerkenswert. Was sind Ihre Ziele für die nächsten Jahre?
Wir sind optimistisch ehrgeizig. Das wäre ich nicht, wäre ich nicht überzeugt, dass wir vieles noch sehr viel besser machen können. Wir müssen neue Dinge ausprobieren, müssen agiler sein und länderspezifisch verkaufen. Deutschland zum Beispiel viel deutscher ansprechen unser Angebot für diesen Markt zuschneiden. Das spannende ist, dass Kunden heute international sehr ähnlich ticken. Wenn sie eine schlechte Saison in Großbritannien haben, haut sie kein anderes Land mehr raus. Genau wie sich Erfolg auch in anderen Ländern fortschreibt: Unsere Top-Ten-Bestseller sind sehr interessant, mindestens fünf davon haben globale Gültigkeit.
Bedeutet Globalisierung also, dass es eine Art globalen Geschmack gibt?
Wenn man verallgemeinert, gibt es noch immer gewisse Gesetzmäßigkeiten – dass die Amerikaner zum Beispiel formeller sind, die Deutschen sind lässiger oder die Briten trendbewusster.
Eine gewaltige Herausforderung an das schöne Buzzword der Personalisierung.
Ja, denn das ist wirklich schwierig. Wird man zu individuell, verliert man die Vorteile der Gemeinsamkeit. Für jeden Markt individuell zu produzieren, bringt Vor-, aber natürlich auch Nachteile.
Genau, zumal Personalisierung ja so oft missverstanden wird, dass man den Leuten die Möglichkeit einräumen müsse, selbst zum Designer zu werden. Das stimmt nicht. Wenn ich zum Abendessen gehe, will ich auch nicht für mich selbst kochen – ich will an einem Ort sein, wo ich weiß, was mich erwartet, das ist der Punkt. Was also ist in der Personalisierung Ihrer Meinung nach wichtig?
Im Grunde ist es ziemlich beschämend, dass wir in ganz einfachen Dingen noch nicht gut sind. Seinen Kunden eine zielgerichtete E-Mail zu schicken, die für ihn relevant ist und seinen Geschmack widerspiegelt, ist zum Beispiel überraschend schwierig. Man denkt, das muss doch einfach sein, aber es für ein Unternehmen zu skalieren, ist wirklich herausfordernd. Das ist übrigens auch ein hervorragendes Beispiel dafür, dass manches besser wird, wenn man als Unternehmen wächst, in anderen Feldern dafür wird man durch Größe schlechter.
Also Fokus weiterhin aufs Produkt?
Spannende Frage. Ja, Nummer eins das Produkt, Nummer zwei die Bilder. Gleich danach kommt das Styling. Das muss sich sowohl im Katalog als auch im Web sehr auf zwei Weisen gut funktionieren: Eine ist die Emotion – eine Verbindung zu schaffen und Menschen denken zu lassen, oooh, das ist aber hübsch. Und der zweite Aspekt von Website und Katalog ist Convenience. Der Größenschlüssel muss stimmen, am Telefon muss alles passen, das ist bei uns gegeben.
Das ist spannend, dass das Smartphone auch hier so wichtig ist.
Man kann das so abkürzen: Wer im Web Erfolg haben will, muss für Telefonbildschirme designen.
Wie interessant, das ist so offensichtlich und logisch, aber niemand sagt das so deutlich wie Sie. Machen Sie eigentlich Marktforschung, also fragen Sie ab, ob sich die Kunden gewisse Dinge wie Individualisierung wünschen?
Nun ja, zuerst muss man immer wissen, wen man fragt und welche Fragen man stellt. Die Personalisierung ist im Grunde ganz einfach: Wir sagen, Stephan, du hast letztes Jahr eine Menge weißer Hemden und noch anderer Hemden bei uns gekauft, daher vermuten wir, dass du dieses Hemd zur Arbeit trägst und schlagen dir ein Sakko dazu vor. Menschen mit relevanten Inhalten inspirieren.
Also geht es darum, das Wissen und den Service, den Sie mit gutem Personal in einem stationären Laden gewährleisten, online zu übertragen.
Ja. Jemand hat einmal gesagt, man solle sich selbst als einen Metzger von der alten Schule vorstellen. Wärst Du in den 1950er-, 1960er-Jahren zu deinem Metzger gegangen, hätte der gesagt: „Guten Tag Stephan, ich weiß, dass du gerne Leber ist und ich habe ganz tolle bekommen… Du hast schon mal Kalbsleber genommen, diesmal kann ich dir leckere Hühnerleber anbieten, die ist auch noch günstiger als die vom Kalb.“ Und genau dieses Prinzip gilt heute noch. Es geht darum, seine Kunden zu verstehen und ihm relevante Alternativen zu bieten.
Was wäre also für Ihr Geschäft eine Alternative, die reizvoll ist? Asien?
Haben wir uns angesehen, ist aber im Moment nicht im Fokus. Generell meine ich, dass man besser dran ist, sich auf Märkte zu konzentrieren, in denen man schon stark ist. Das mag wie ein Klischee klingen, aber es ist immer profitabler, in einem bestehenden Markt von sieben auf zehn zu wachsen als in einem neuen von null auf drei.
Profit over Turn-over?
Wer Gewinn macht, kann es sich leisten, etwas Neues zu probieren. Es wäre töricht zu denken, dass ein neuer Markt dich rettet, wenn Dinge falsch laufen. Ich finde es heute spannend, welche Wirkung kleine Verbesserungen haben.
Ein Beispiel?
Schon leicht verbesserte Farben, bessere Drucke, Töne, die Kunden besser stehen, bessere Models, ansprechendere Fotografie, eine bessere Website. Zählt man all diese Faktoren zusammen, merken wir, dass der Unterschied zwischen einem richtig guten und einem guten Kleid enorm ist. Von manchen Kleidern verkaufen wir 50.000 Stück in der Saison, von anderen nur ein paar hundert. Auf den ersten Blick versteht man nicht, warum, aber wenn man darüber nachzudenken beginnt, erschließt sich plötzlich alles: Die Länge ist perfekt, es ist super fotografiert, es passt dem Model wunderbar, die Farben kommen schön rüber – und all diese Dinge kann man vergleichsweise gut beeinflussen. Trotzdem ist das noch nicht die Zauberformel, denn wenn man an so viele Dinge gleichzeitig denken muss, ist das Wichtigste, fokussiert zu bleiben.
Ist es schwer, die richtigen Leute für das alles zu finden?
Und wie! Es ist ja eine Industrie, die sich gerade erst entwickelt. Wenige bringen Erfahrung mit, es sei denn, sie haben sich einfach ans Machen gewagt. Aber dann haben Sie ein anderes Problem: Menschen, die die Intelligenz haben, so umsichtig zu sein, entscheiden sich oft, selbstständig zu werden. Außerdem steht man als Arbeitgeber im Wettbewerb mit großen Unternehmen. Wir haben großartige Leute hier, aber es dauert sehr lange, sie zu finden.
Freilich, und dann ist es auch Tech, also eine Branche, in der Spezialisten eher geneigt sind, für Mercedes als für ein Modeunternehmen zu arbeiten, weil da – zumindest bei uns in Deutschland – eine höhere Affinität besteht. Apropos Deutschland und seine Besonderheiten: Wie stehen Sie zur hohen Rückgaberate in diesem Land – und generell?
Retouren muss man einfach akzeptieren, besonders in Deutschland, wo die Kunden gerne auf Rechnung kaufen und gleich mehrere Größen zur Auswahl bestellen. Da geht die Hälfte dann sicher zurück.
Ist das in UK besser?
Ja, die Leute zahlen mit Kreditkarte und damit ist die Warenkorbgröße nicht so spektakulär wie in Deutschland.

Was bedeutet das für die Retourenquote?
Deutschland hat etwa 60 Prozent, wir irgendwo zwischen 30 und 40. In unserem Brompton Warehouse in Leicester waren ursprünglich mal zwei Drittel für den Versand und ein Drittel für die Retouren reservieret. Heute brauchen beide Abteilungen genau die Hälfte des Platzes.
Das ist ein Thema, das mich lange begleitet. Vor zwölf Jahren hat Ron Herman diese Saat in einem Interview gesät, als er sagte, er würde 50 Prozent und mehr Retouren als Signal sehen, dass der Onlinehandel einen schlechten Job macht. Der Vergleich hinkt, weil die Retourenquote ja mit der Umkleidekabine eines Geschäfts verglichen werden müsste. Gehe ich mit vier Hosen rein, kaufe aber nur eine, hat dieser Laden auch eine Retourenquote von 75 Prozent. Folglich muss man die Retoure im Onlinehandel gewissermaßen hinnehmen, ja. Neu ist die Diskussion über die Umweltaspekte der Onlineretouren.
Ja, darüber kann man sich trefflich streiten. Wobei ich der Meinung bin, dass ein fairer Vergleich von On- und Offline einberechnen müsste, dass man zu dem Geschäft kommen muss oder dass Läden viel Strom brauchen. Wofür man die ganze Branche an den Pranger stellen kann, ist Plastik. Das viele Plastik, das wir brauchen, weil Lagerhäuser eben nun mal kein sauberer Ort sind und man die Kleidung so schützt. Wir suchen da intensiv nach Alternativen und ich denke, dass wir im nächsten Jahr so weit sind.
Beeinflusst die Umweltdiskussion auch die Wahl der Produktionsländer? Weil Sie sich eventuell schon rüsten müssen für Einfuhrzölle oder eine Steuer auf lange Transportwege?
Wir produzieren aktuell im nahen und fernen Osten, Südeuropa, der Türkei und Nordafrika, aber wir versuchen, die nahen Produktionsstandorte auszubauen. Das ist bis zu einem gewissen Punkt auch möglich. Die Umweltdebatte ist gut. Wir überlegen uns zum Beispiel, unseren Kunden kostenlose Reparaturen zu ermöglichen, wir geben lange Garantien, wir wollen einfach generell, dass die Leute weniger, aber besser kaufen. Es gibt Unternehmen, die sehr viel mehr Schuld an der schlechten Ökobilanz der Modeindustrie trifft als uns. Wir produzieren nur in geprüften Fabriken und inspizieren sie regelmäßig. Ich bin ziemlich stolz darauf, was wir tun. Aber es fällt mir schwer, zu sagen, wir wären ach so brillant in dem Thema, weil es immer irgendeinen Aspekt gibt, in dem man dann eben doch noch nicht brillant ist. Und das hauen einem Journalisten dann um die Ohren.
Johnnie-Boden_style-in-progress-120